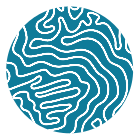„No lager“ ist eine der Forderungen von Migrant*innen. In Zeiten von Corona wird das Zusammengepferchtsein noch bedrohlicher – und fällt paradoxerweise stigmatisierend auf die Eingezäunten zurück. Doch Lager sind immer Ausdruck einer Abwertung. Von Rassismus und Klassismus. Oder könnten wir uns das in Blankenese oder Zehlendorf vorstellen?
In Göttingen wurden Wohnblocks eingezäunt, in denen eine vielfältige Mischung von Menschen wohnen, die aber vereint, sozial deklassiert zu sein. Die Quarantäne galt auch für alle, die negativ getestet wurden – wobei oft gar keine Tests zur Verfügung gestellt wurden. Selbst sich woanders in Quarantäne unterzubringen, war nicht erlaubt. Als einzelne der 500 Erwachsenen und 200 Kinder nach Tagen versuchten herauszukommen, wurde Pfefferspray in den Durchgang gesprüht.
Der AK Arbeitskämpfe der Assoziation Kritische Gesellschaftsforschung hat eine Solidaritätserklärung veröffentlicht.
Zuvor hatte bereits der Göttinger Roma Center e.V. gegen stigmatisierende und rassistische Zuschreibungen und Maßnahmen der Stadt Göttingen, des Klinikums und der Medien interveniert. Später war es dann auch in anderen Medien zu lesen: Statt auf ‚Feiern von Großfamilien‘ ist der Corona-Ausbruch auf besonders eine davon unabhängige Person zurückzuführen, die bereits unter Quarantäne stand und diese nicht einhielt. Mitglieder jener Familien, die anschließend kriminalisiert wurden, hatten demnach die Behörden mehrfach darauf hingewiesen, dass sich der Mann nicht an die Quarantäne hielt. Die Behörden reagierten nicht. Später, trotz der Einzäunung, verweigerte die Stadt Göttingen die ausreichende Versorgung und Unterstützung für Bewohner*innen. Die betroffenen Familien haben die Angelegenheit anschließend in die eigenen Hände genommen: Sie haben ihre Wohnsituation so organisiert, dass die Menschen mit positivem Corona-Ergebnis in einer Wohnung leben und die Gesunden in einer anderen. Die Gesunden versorgen ihre unter Quarantäne stehenden Angehörigen mit den Dingen des täglichen Bedarfs.
Dass es von seiten der Stadt auch einen anderen Umgang geben kann, zeigt die Politik unter der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci: Berlins Bezirke setzen auf Sozialarbeiter* und Kommunikation. Anders als in Göttingen wurden keine Zäune aufgebaut oder Hundertschaften der Polizei eingesetzt. Getestet wurden die Menschen in den Wohnungen. Das Technische Hilfswerk und das Rote Kreuz versorgen die Bewohner*innen mit Grundnahrungsmitteln. Hygieneartikel, Medikamente und Babynahrung werden durch ehrenamtliche Helfer*innen verteilt, Übersetzer* erklären die Maßnahmen. Im angrenzenden Bernau gab es vor einem unter Quarantäne gesetzten Haus ein Solidaritätskonzert. In Potsdam hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, mittelfristig alle Sammelunterkünfte in der Stadt aufzulösen
Und wie es ist mit den Arbeiter*n der Schlachtfabrik Tönnies, den Menschen aus Osteuropa, die Billig-Jobs übernommen haben, weil sie aus Billig-Lohnländern kommen, damit das Fleisch auf dem deutschen Tisch billig bleibt? „Wir sind vier Personen in einem Zimmer. Wir dürfen aber nicht zu viert sein, sondern nur zu zweit, da die Luft zum Atmen nicht ausreicht. Aus diesem Grund werden viele Leute krank, weil da einfach keine Luft ist“, so ein vom Spiegel interviewter rumänischer Arbeiter in Quarantäne. Wer zuvor in der Zeit von Vanessa Vu den Artikel 20 Dezibel gelesen hat, in dem es darum geht, dass auch George Floyd hätte atmen können, doch nicht atmen durfte, und „wer atmen darf und wer den Atem nimmt, das entscheidet sich entlang historisch gewachsener Bruchlinien“, wird daran denken müssen:
"Garner und Floyd waren nicht die Einzigen, denen ein rassistisches System durch seine staatlich verankerten Abwehrmechanismen den Atem nahm. Denkt man die Metapher weiter, dann ersticken Menschen eigentlich täglich bei ihrem Versuch, an der westlichen Welt teilzuhaben, nur lösen ihre Tode selten Massenproteste aus. Ihr Sterben wird nicht gefilmt und in sozialen Medien verbreitet. Kaum jemand sagt ihre Namen. Kaum einer kennt ihre Namen. Da wären zum Beispiel die Tausenden Flüchtlinge, deren Boote auf dem Mittelmeer kentern. Es ist häufig von Ertrinken die Rede, richtig wäre aber Ersticken. Sobald in die menschlichen Atemwege Wasser kommt, es können schon sehr kleine Mengen sein, verkrampft sich im Kehlkopf die Stimmritze. Der Mensch erstickt, selbst wenn er wieder an die Oberfläche geholt wird. Es braucht dafür kein Wasser in der Lunge. Im Jahr 2019 starben laut UNHCR 1.319 Menschen auf dem Mittelmeer, im Schnitt etwa vier pro Tag. In diesem Jahr sind es 186 Tote, fast jeden Tag eine Person. Und warum nicht auch die Menschen dazuzählen, die versuchen, auf dem Landweg in geschlossenen Containern nach Europa zu gelangen und dort keine Luft mehr bekommen? Ersticken nicht auch sie letztlich an einem tödlichen Grenzregime? Im Jahr 2015 wurden 71 tote Männer, Frauen und Kinder in einem Lkw gefunden. Sie kamen aus dem Irak, Syrien und Afghanistan über die sogenannte Balkanroute und wollten nach Deutschland. Ihre Fahrt endete in Österreich, ihr Leben bereits in Ungarn. Sie waren laut Obduktionsbericht innerhalb von anderthalb Stunden im Lkw erstickt. Und am 23. Oktober 2019 erstickten wieder Menschen in einem Lkw. Diesmal 39 Frauen und Männer aus Vietnam. Sie wurden in England gefunden. Eine von ihnen war die 26-jährige Pham Thi Tra My. 'Es tut mir so leid, Mama', schrieb sie kurz vor ihrem Tod ihrer Mutter. 'Ich hab's nicht geschafft, ins Ausland zu gehen. Ich hab euch lieb, Mama und Papa. Ich sterbe, weil ich nicht atmen kann.'"